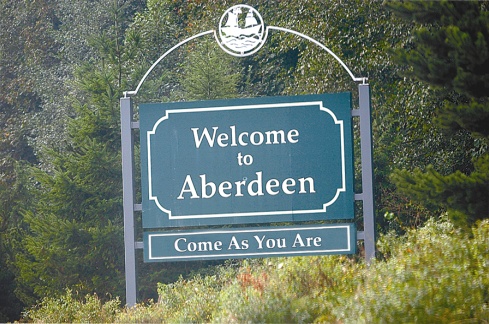Alte Musik eignet sich prima zur Realitätsflucht. Alte Musik, das sind Lieder, die bekannt sind, ohne dass das erste Hörerlebnis noch präsent wäre. Bei mir löst sich dieses Rätsel meistens auf eine von zwei Weisen. Entweder es ist Sonntagabend, gegen halb acht, und mein Vater legt eine Platte auf, um die Zeit zwischen Essen und Tagesschau zu überbrücken. Dann kommt immer wieder der Moment, in dem ich frage: „Wer ist das? Das kenn ich!“ Mal ist es Jackson Browne, mal Adriano Celentano (das war, als wir Rossinni geguckt haben, eingangs läuft Azzurro von ihm), zuletzt war es Joe Jackson. Andersrum passiert das auch, mein Vater hat sich extra ein Album von Kid Kopphausen gekauft, um es mir zu schenken nachdem ich es ihm empfohlen hatte. Meine Mutter rastete jüngst fast aus, als ich über die Stereoanlage This Land is Your Land von Woody Guthrie spielte – danke, John Green! Die andere Art und Weise auf die ich merke, dass ich Musik kenne, sind Freunde. Neulich sind wir irgendwo am Südfriedhof im fünften Stock in einer Wohnung, die eindeutig nach Katze riecht und nach Umzug aussieht und Linus macht plötzlich Mike & The Mechanics an. Ich kenne, erkenne aber nicht und erfahre aus Linus‘ Mund, dass Mike einer von Genesis ist. Da sitze ich nun, 24 Jahre jung und fühle mich, als regierte Birne Kohl noch. Die Musik ist nicht wirklich mein Ding, aber die Erinnerungen sind wunderbar. Mit drei war das Leben aufregender. Gerade deshalb ist alte Musik so toll, man denkt an andere Zeiten und hat nur das Beste vor Augen.
Was die Musikauswahl angeht, denke ich natürlich elitär. Alles, was ich aktiv rezipiert habe, hat eine gewisse Qualität zu haben, alles, was ich davor gehört habe, geht immer durch. Ich setze die aktive Rezeption irgendwo im Jahre 1998 an, das stimmt angesichts der Tatsache, dass ich Anfang 2001 40 Mark für ein Album von Christian, dem Nominator ausgegeben habe, zwar eindeutig nicht, aber immerhin sang ich schon 1997 We Will Rock You schief aber schwerst begeistert mit. Irgendwo zwischen 5 und 15 muss es also begonnen haben. Mein Vater hat die Anschaffung von drei Queen LPs, zu der ich ihn damals nötigte, mittlerweile verschmerzt. Vor gut zwei Monaten war ich, weil ich noch Schnaps hatte, zu Gast bei einer Freundin, die seit einigen Monaten hier studiert. Zu den weiteren Gästen gehörte auch eine junge Dame, die das Sum 41 Album Chuck mit den Worten „Das weckt so viele Erinnerungen“ kommentierte. Für mich ist das Werk allenfalls mit MTV-Gucken nach der Schule verbunden: Pieces kam 2005 dauernd auf TRL. Ansonsten finde ich Sum 41 musikalisch eher underwhelming. 2005 war das Jahr von 50 Cents The Massacre und The Games The Documentary – ich wollte damals schwarz und Drogendealer sein, nicht emotional verwirrt und Kanadier. Überhaupt muss man die Integrität eines Menschen in Frage stellen, der Avril Lavigne erst heiratet und dann an Chad Kroeger verliert. Wenn das Schicksal, und davon ist auszugehen, Humor hat, ist infolge dieser Analogie eine meiner Exfreundinnen momentan mit Joris oder Mark Foster liiert.
Um zum eingangs geäußerten Gedanken zurückzukommen: Musik ist Erinnerung in Schallwellenform. Musik erinnert uns an die Kindheit, an erste Küsse (ich wünschte, ich könnte Coldplay hassen, aber es geht nicht, verdammt, Marina!), an Feiern, manchmal auch ans Loslassen (The River) oder Beerdigungen (Days). Das Schlimme an dieser Eigenschaft von Musik ist nicht, dass wir uns erinnern, es ist die Art, wie wir uns erinnern. Wir selektieren und verklären: Dass wir sehr wütend waren als es vorbei war, ist egal, wenn The Scientist uns an Liebesbriefe erinnert. Dass Oma echt rassistisch drauf war, ist egal, weil Twist and Shout sie dazu brachte, aus ihrer Jugend zu erzählen. Du hast damals drei Stunden lang Whiskey Cola erbrochen, aber wenn du die Black Eyed Peas hörst, dann … STOPP! Niemand, der nicht taub ist, kann beim Hören der Black Eyed Peas positive Emotionen haben, dafür gibt es Kokain.
Des Erinnerns wegen haben Menschen Lieder, die „ihre“ sind, des Erinnerns wegen wirkt Bye Bye Baby auf einer Beerdigung deplatziert, des Erinnerns wegen grölen Menschen „Ein Feuerwerk aus Endorphinen“ laut mit – selbst Drake lebt ja für die Nächte, an die er sich nicht erinnert, mit den Leuten, die er nie vergisst. Tattoos sind halt teurer als eine Spotify-Playlist; da nimmt man es dann eben in Kauf, dass Purple Rain nur auf Tidal verfügbar ist. Zur Not kann man ja auch italienische oder französische Popmusik hören. Neks Liebeslied Laura non c’è eignet sich ganz wundertoll für die störrische Phase des Verlassenwerdens, Carla Bruni und Quelqu’un m’a dit ist dann eher für den anderen Part, den verlassenden. So lernt man nebenbei auch noch, wie man in poetischeren Sprachen als der eigenen über die Liebe redet. Anderes Liedgut scheint der südeuropäische Raum ja auch nicht zu kennen.
Musik zu hören ist schön. Ich denke gerne daran, wie mein Vater meine erste Verliebtheit und das folgende Drama gekonnt mit Is She Really Going Out With Him untermalte, wie die erste richtige gescheiterte Beziehung dazu führte, dass ich täglich neue Lieder mit dem Namen meiner Ex per Mail bekam – ich fürchte, mein Vater sammelt jedes Mal, wenn sein Sohn verliebt ist, Lieder, die den Namen der aktuellen „Favoritin“ enthalten, nur um für den Verteidigungsfall gerüstet zu sein. Ich kann aus ähnlichen Gründen Cheeleader von OMI nicht hören, ohne zu grinsen, 2006 konnte in der Deutschland GmbH niemand Xavier Naidoo entkommen – ob mit oder ohne Sönke Wortmann. Bei all dem Nutzen, den Musik für uns hat, sollten wir ihre Funktion als Medium aber nicht überhöhen. Musik erinnert uns, lässt unsere Gefühle heftiger aufleben oder betäubt sie. Sie ist Mittel zum Zweck, nicht die Lösung des Problems. Wenn ich mich erinnere und der Melancholie einen Schuss Peter Gabriel dazugeben will, ist das recht und billig – wenn ich Musik nutze, um mich abzukapseln, kann das ein Problem werden. Wenn ich mit der Welt nicht klar komme, brauche ich Hilfe, kein Hello von Adele. Die Wohnung, die nach Katze roch und nach Umzug aussah war voller Nirvana-Plakate, die Gastgeberin trug scheinbar nur T-Shirts mit Kurt Cobains Konterfei. Ist das noch Fandom oder schon Fanatismus? Sollten wir uns nicht alle auch einmal eine Auszeit nehmen, den Regen genießen und in Stille über alles nachdenken? Ohne Licht ist es weniger gefährlich, vielleicht ist es ohne Musik manchmal auch besser.
Bildquelle: Paul Fritts
Paul war seit Ende 2012 Teil der Redaktion. Neben der Gestaltung des Layouts schrieb Paul gerne Kommentare und ließ die Weltöffentlichkeit an seiner Meinung teilhaben. In seiner Freizeit studierte Paul Deutsch und Anglistik an der CAU.