Uraufführung des Lübeck-Epos’ Buddenbrooks zwischen Buhrufen und Applaus
Thomas Manns Jahrhundertroman Buddenbrooks ist mit seinen Schauplätzen in und um Lübeck mit der Region fest verwoben. Umso mehr überrascht es, dass nun das Theater Kiel den Stoff mit einem Auftragswerk in die Landeshauptstadt holt. Zusätzlich nicht mal als Schauspiel, sondern als Oper. Kann man dieses Werk überhaupt vertonen? Und was hat es in der heutigen Zeit noch für eine Aussagekraft? Auf diese Fragen versuchen das Autorenteam aus Feridun Zaimoglu und Günther Senkel (Text) sowie Ludger Vollmer (Komposition) Antworten zu finden.
Die Grundidee Thomas Manns Lübeck-Epos in Kiel aufzuführen, entstammt einem Einfall Daniel Karaseks, dem Generalintendanten des Theater Kiel sowie Regisseur dieser Inszenierung. „Mich hat zunächst der Stoff an sich gereizt: diese vom Tod vollgesogene, sicher beim Lesen etwas langatmige Familientragödie, die in der eigenen Reflexion dann aber große opernhafte Figuren offenbart“, so Karasek. „Es sind große Konflikte, die verhandelt werden, die eigentlich par excellence ins Musiktheater passen.“ Tief tragische Figuren eignen sich besonders für die Opernbühne, da Emotionen, die in tieferen Schichten liegen, durch die Musik viel einfacher und unterschwelliger hervorgebracht werden können.
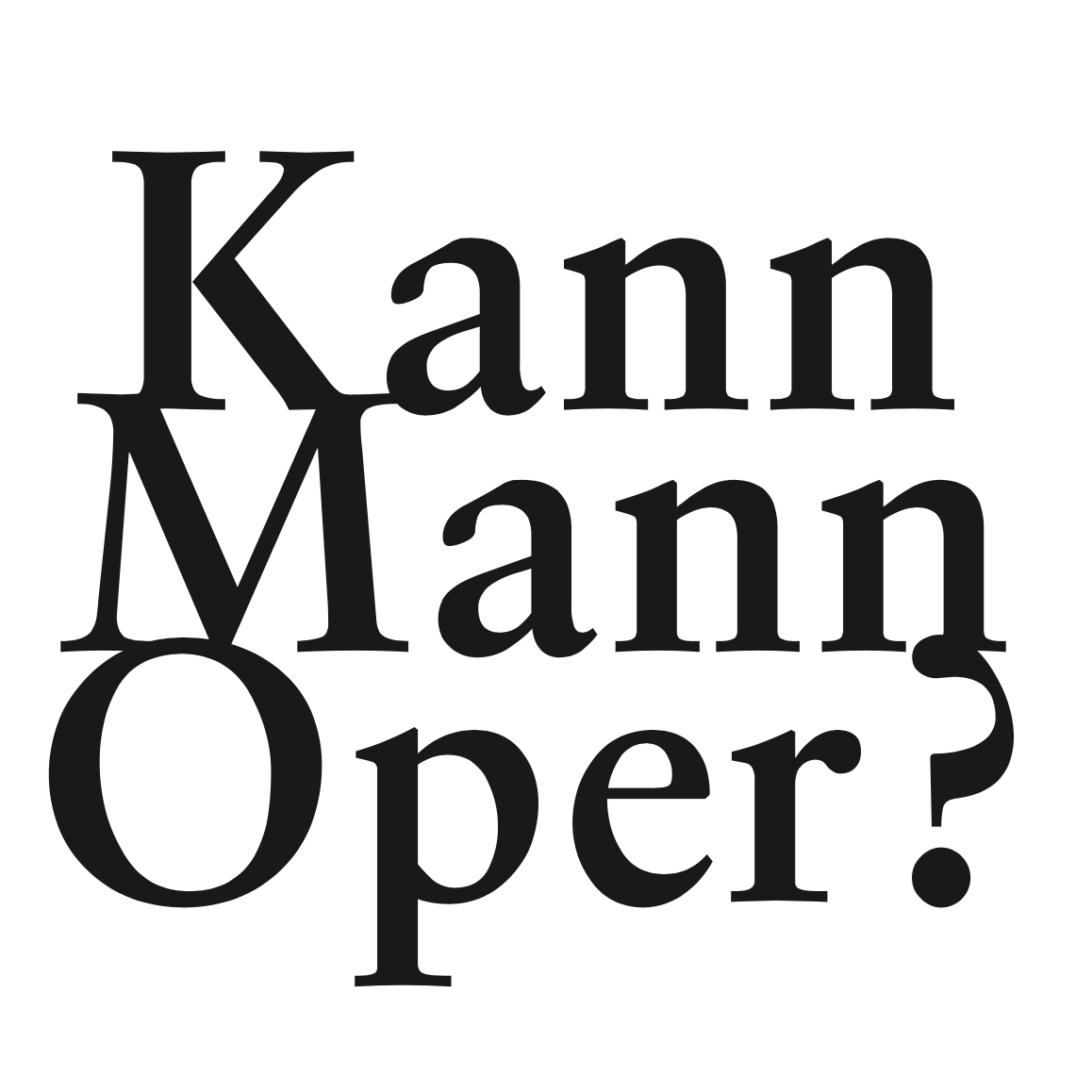
Allerdings habe sich dann die Frage gestellt, wie ein solch umfassendes Werk überhaupt auf Opernlänge gebracht werden kann. Komponist Vollmer sei gleich Feuer und Flamme für das Projekt gewesen – aber unter einer Bedingung: Er bestand auf den Kieler Feridun Zaimoglu als Autor der Textfassung. Zaimoglu war auch vorher schon an Produktionen des Theater Kiels beteiligt. Dieser habe dann noch Günter Senkel ins Boot geholt. Karasek: „In diesem Moment war die Entstehungsdramaturgie im Grunde perfekt.“
Beim Blick in Ludger Vollmers Partitur fällt dabei die Vielzahl tiefster Instrumente wie Kontrafagott und Basstuba auf. Komponist Vollmer erzählt im Vorgespräch, die tiefen Klänge könnten durch ihr Schnarren selbstverständlich Schreckensmomente unterstreichen, allerdings sind sie eigentlich vielmehr geschickt in Pärchen mit anderen Orchesterinstrumenten eingesetzt, um etwa die hohen Koloraturen Xenia Cumentos (als Tony Buddenbrook) abzurunden. So sorgt das Kontrafagott für einen wohlig warmen Bass im ganzen Haus, während die höheren Töne ausgestaltet werden. „Diese Klänge rasten optimal ineinander ein und befruchten sich dadurch gegenseitig“, erzählt Vollmer.

Die Rolle des Familienoberhaupts und Senators Thomas Buddenbrooks fällt dem Kieler Kammersänger Jörg Sabrowski zu, der bei unfassbar klarem Bass und sprachlicher Präzision – wenngleich auch textlicher Freiheit, Passagen nach dem eigenen Gusto auszugestalten – die Familiengeschicke im Andenken an den Stammvater Johann Buddenbrook leitet. Seine Frau Gerda (Tatia Jibladze) ist währenddessen eher an dem jungen Leutnant von Throta (Gabriel Wernick) interessiert, der als einer von vielen versucht, den Familienfrieden ins Wanken zu bringen. Michael Müller-Kasztelan meistert Vollmers Harmonieläufe als jüngerer Bruder Christian Buddenbrook tadellos, doch leider kommt seine Rolle in der Gesamtsicht etwas kurz. Die jüngste Schwester Clara Tiburtius, geb. Buddenbrook, hat ebenfalls nur einen kurzen Auftritt im ersten Akt. So kann Clara Fréjacques nicht ihren anmutigen Mezzosopran in voller Pracht präsentieren. Ihr Mann, Pastor Sievert Tiburtius, begleitet jedoch das gesamte Geschehen und Matteo Maria Ferretti muss mit ihm einen wahrhaft grässlichen Charakter verkörpern.
Greenwashing auf der Opernbühne
Dann wären da noch die stark überzeichneten, gar karikaturesk ausstaffierten Brüder Hageström (Konrad Furian und Stefan Sevenich), die als seine schärfsten Konkurrenten den ach so umweltbewussten Waffenhändler Thomas Buddenbrook nach allen Regeln der Kunst aufs Korn nehmen. So habe er das kleine Image-Elektroauto vor dem Innenstadthaus in der Mengstraße und den dicken SUV in der Tiefgarage geparkt. Diese Seitenhiebe und überhaupt das ganze Hagenström’sche Auftreten erheitern zwar das Publikum, wirken aber auch etwas krampfhaft, eingefasst in den aktuellen Diskurs der Gesellschaft. Zumal diese Aktualität sich nicht durch alle Rollen dieser Neuauflage hindurchzieht.
Mit Xenia Cumento hat das Kieler Theater einen wahren Gewinn gemacht. In ihrer Rolle als kampf-feministische Tony Buddenbrook bricht sie mit ihrer glockenklaren Stimme zeitweilig aus den üblichen Registern aus und verleiht ihrem Unmut Ausdruck. Eindeutiger Star der Produktion ist allerdings Elmar Hauser. Der Countertenor gibt der nicht-binären Figur Hanno Buddenbrook eine Stimme – und was für eine. Virtuos und dabei unfassbar melancholisch trägt Hanno der zerstrittenen Familie, sich selbst auf der Theorbe begleitend, Variationen von Rilke-Gedichten vor und zieht die Zusehenden förmlich an.

Ebenso überzeugt der Philharmonische Chor unter der Leitung von Gerald Krammer auf ganzer Strecke und verleiht dem Stück das gewisse Etwas. Die Sänger*innen sind in der Inszenierung omnipräsent und hauchen dem starren Bühnenbild als Hausbedienstete, Gäste, Trauerchor oder Abrissarbeiter*innen Leben ein. Der Kinderchor der Akademien am Theater Kiel zeigt sich als gutes Gewissen der Figuren und rundet die Statisterie ab.
Lars Peter, bei dieser Produktion für das Bühnenbild verantwortlich, hüllt die gesamte Bühne des Opernhauses in zartes Türkis und schalt die Spielstätte mit dem Festsaal des Buddenbrook’schen Hauses komplett ein. Dennoch klappt der Szenenwechsel durch Veränderungen der Lichtverhältnisse und der Einrichtung reibungslos. Die Kostümierungen überzeugen durch gezielte Zurückhaltung und klassische Eleganz. Dabei hatte Claudia Spielmann allerhand zu tun bei über 300 Kostümen für Cast, Chor und Kinderdarsteller*innen.
Am Ende des Abends kassierten Vollmer, Zaimoglu und Senkel neben tosendem Applaus auch einige, teils inbrünstig vorgetragene Buhrufe. Die Buhenden haben bewusst die künstlerische Leistung der Darsteller*innen gewürdigt, erteilten der möglicherweise so aufgefassten Verhunzung des Originals durch das Autorenteam jedoch eine Absage. Doch ihnen sei eines gesagt: Kunst so wie die Musik entsteht im Hier und Jetzt für das Hier und Jetzt. Verdi, Saint-Saëns und Tschaikowsky haben für ihre Zeit geschrieben und so schreibt auch Vollmer für seine Zeit. Aber seine Zeit ist heute. Den Zuschauenden muss beileibe nicht alles gefallen, was aufgeführt wird. Auch davon lebt das Medium Theater. Aber sie sollten sich öffnen. Öffnen für Neues, Mutiges, Anderes. Dass heutzutage ‚alte‘ Musik gehört wird, ist ein verhältnismäßig neues Phänomen. Und wie wir in 100 Jahren auf die Kieler Buddenbrooks blicken, kann niemand vorhersagen.
Und so bleibt es dem Publikum selbst überlassen, sich ein Bild von den Kieler Buddenbrooks zu machen und ein Urteil über die moderne Opernlandschaft des aktuellen Jahrhunderts zu fällen. Die Möglichkeit dazu bietet sich am 24.05., 02.06., 22.06., 04.07. und 14.07. im Kieler Opernhaus (Rathausplatz 4). Drei Tage vor dem Veranstaltungstermin kann eine kostenlose Karte über das Kulturticket gebucht werden. Nähere Infos finden sich unter www.theater-kiel.de/kulturticket.
Finn ist seit Februar 2024 Chefredakteur des ALBRECHTs. Zuvor hat er ein Jahr lang das Kulturressort geleitet. Für unser Blatt sitzt er häufig in der Oper, im Theater oder im Konzertsaal. Er studiert Englisch und Geographie auf Lehramt und ist seit dem WiSe 22/23 Teil der Redaktion.



